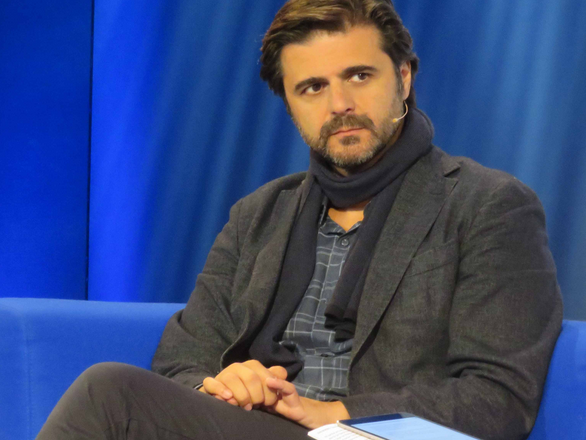Fragebögen & Trick 17

Henning Sußebach über Holger Gertz
„Vor ein paar Jahren sah es kurz so aus, als könne Bremerhaven im Offshore-Windrad-Business durchstarten, das hat aber auch nicht richtig geklappt, in Bremerhaven, wo das Glück nicht oft zu Hause war, angemessen pathetisch gesagt.“
Das schreibt Holger Gertz in seiner Reportage „Ihr schon wieder“ über den Bremerhavener Zoo, erschienen im März 2021 in der Süddeutschen Zeitung. Gertz ist dort das, was viele Reporterinnen und Reporter in diesen pandemischen Monaten sind: ziemlich allein! Szenen sind eher selten, Gesprächspartner hat man auch nicht viele, Gegenwart ist etwas knapp. Umso wichtiger werden Rückblicke, Einordnungen, Gedanken. Die schaden keiner Reportage, nur klingen sie schnell kitschig oder zu dick aufgetragen. Gertz löst das Problem, indem er eventuellen Kitsch benennt („pathetisch gesagt“) und sich zugleich davon freispricht („angemessen“). Ein Halbsatz, nur drei Worte, die seiner Reportage eine Reflexionsebene hinzufügen.

Holger Gertz über Christoph Scheuermann
„Sein T-Shirt über dem Bauch spannt, als hätte Genion versehentlich einen kleinen Mond verschluckt.“
So schreibt Christoph Scheuermann über einen belgischen Sommelier in seinem Stück „Der erfundene Bär“, erschienen im März 2015 im Spiegel. Die Beschreibung der Äußerlichkeit von Personen ist eine zunehmend sensible Angelegenheit, schnell wird sie im Netz (oder auch in der Redaktionskonferenz) als beleidigend oder sonstwie übergriffig gebrandmarkt. Nun gehört es aber zum Auftrag von Reporterinnen und Reportern, Menschen, Orte, Dinge zu beschreiben, und die Art, in der sich eine Person optisch darstellt, sagt etwas aus über diese Person, ist also unbedingt beschreibungswürdig. Wie aber das Nötige formulieren, ohne unnötig zu verletzen? Es kommt, mal wieder, auf ein Wort an. Scheuermann vertraut hier dem Zauberwörtchen „klein“. Der „kleine Mond“ ist als Beschreibung für Körperfülle deutlich genug, aber weniger hämisch als der „pralle Mond“ oder auch nur „der Mond“. Und das Foto des Sommeliers, das der Spiegel dazugestellt hat, unterstreicht nur die Fairness des Autors.

Christoph Scheuermann über Marlene Knobloch
Ein Seniorenheim in Potsdam, fünf Damen beim Bingo: "Da sitzen sie also wieder." Was für ein schöner, lakonischer erster Satz von Marlene Knobloch in ihrer Reportage "Bingo!" für ZEITonline – und zugleich Kern der Geschichte. Viele Reporterinnen und Reporter tun sich schwer damit, das Überraschende im Alltäglichen wahrzunehmen, das Neue im Gewöhnlichen. Wie macht man da ausgerechnet einen Bingo-Nachmittag interessant? Am wichtigsten ist es, so einem Text ein Thema zu geben, ein Motto – in diesem Fall das Überleben einer Bingo-Runde gegen alle Widrigkeiten, das Überstehen einer Pandemie ... und die Rückkehr des Alltags mit all seinen Banalitäten. "Mit der Normalität kehren eben auch die Niederlagen zurück." So schreibt es Knobloch. Ihr Text ist eine Hymne an die Normalität, eine Ode an die Freundschaft, ans Überleben. Dieses Thema zieht sich durch die Reportage, es hält die Geschichte erst zusammen. "Da sitzen sie also wieder." So steht es da. Genauso muss es da stehen.

Marlene Knobloch über Dmitrij Kapitelman
"In einem dieser breit bestrahlten, nach Legenden lechzenden Promenadenhotels, die sich selbst als eine Stadtattraktion verstehen, nicht als bloße Übernachtungsmöglichkeit. "
Die erste Reise nach der Pandemie. Zwei junge Männer fahren gemeinsam die Küste entlang. Genua, San Remo, Nizza, Cadaques. Wie wird so ein Trip für den Leser interessant? Wie beschreibt man diese Orte, das Meer, den Sonnenuntergang, wo doch alles von Schriftstellern und Reportern seit Jahrhunderten bis zum Kitschtod beschrieben wurde? Wie erzählt man
Schönheit? Dmitrij Kapitelman macht in seiner Reportage "Schön ist die Welt" für die ZEIT die Situation zum Protagonisten: Das Meer, die Luft, die Promenadenhotels – sie alle sind keine eigenschaftslosen Objekte. Sie machen etwas mit dem Reporter. Eine Reise sollte sowieso nie daraus bestehen, die Umwelt in einseitiger Beziehung zu konsumieren. In Kapitelmans Text dürfen sie interagieren: Da ist die warme Luft des Südens, die die Menschen noch liebt, San Remo ist "das Lieblingskind der Welt" und Promenadenhotels in Nizza sind stolze Wesen. Klar, denn in ihnen passieren Geschichten, in ihnen übernachten Stars, in ihnen fließt der Champagner, den sich Normalsterbliche niemals leisten können. Sie verstehen sich als "Stadtattraktionen" und liest man Kapitelmans Text, weiß man: völlig zu Recht.

Dmitrij Kapitelman über Cornelius Pollmer und Roman Deininger
Eine Reise im Wahlkampfsommer auf der Autobahn A4, von West nach Ost, von Aachen nach Görlitz. Diese Idee kann schon mal im Stau der Beliebigkeit steckenbleiben. Aber Cornelius Pollmer und Roman Deininger entwickelten in der Süddeutschen Zeitung einen wirklich fantastischen Essay daraus. Wobei mir ein Kniff besonders imponiert hat. Beim Bau des sogenannten Portals, also dem Teil, der den Leser*innen die anliegende Idee verkauft.
Das ist manchmal eine hundsgemeine Aufgabe, da es natürlich nichts Neues unter der Sonne gibt. „Man hat sich selbst die Hoffnung aufgebürdet, dem Land bei dieser Reise durch den Wahlkampfsommer ein wenig näherzukommen“, schreiben die Autoren. Der Trick besteht hier schlicht in einer gewissen Ehrlichkeit. Nein, die Wahrheit liegt nicht immer dort wo unser Journalistenauge hinfällt, wir sind keine Götter der Erkenntnis, die an der A4 die Zukunft der Menschheit ablesen können. Aber wir versuchen es halt, ein wenig, irgendwie. Diese etwas selbstironische Bescheidenheit steht unserem Beruf recht gut zu Gesicht, wie ich persönlich finde.

Cornelius Pollmer und Roman Deininger über Denise Peikert
Falls jemand gerade einen guten Feature-Einstieg sucht, hier kommt einer wunderbar unvermittelt mit der Tür ins Haus: „Seit fast 30 Jahren kennen sich Giesela Renner und Cornelia Woitek, die Patientin und ihre Hausärztin – was sind da schon knapp zwei Jahre Pandemie?“ Mit dieser Leitfrage beginnt Denise Peikert ihren Text in der Leipziger Volkszeitung – und so zügig es losgeht, so dicht geht es weiter. Die Kunst des Features ist es, die Reportage-Elemente richtig zu dosieren, den Blick auf Informationen nicht durch zu viel Ornament zu erschweren – und dabei trotzdem eine Stimmung zu fixieren, mit ganz wenigen Sätzen und klug gewählten Zitaten. Sie werde „vor Weihnachten bestimmt noch einmal“ vorbeischauen, sagt Patientin Renner, als säßen hier zwei gute Freundinnen beim Kaffeeklatsch. „Diese Beschimpfungen, diese Misstrauensanträge gegen die Hausärzte, die da aus der Politik kommen, die tun weh“, sagt Ärztin Woitek und stellt damit implizit die Frage, ob die Impfkampagne nicht anders viel besser hätte laufen können. Antworten bekommt sie praktischerweise gleich im selben Text.

Denise Peikert über Felix Stephan
Als die Leipziger Buchmesse im Winter 2022 abgesagt wird, schreibt Felix Stephan in der Süddeutschen Zeitung einen Text, der so gar nicht mal oft gelingt: einen recherchierten Essay, eine Verbindung von Argumenten und Fakten. Schon die Chronologie der Absage „muss verstören“ schreibt Stephan etwa, deutlich eine Meinung, die er dann aber präzise mit den Ergebnissen seiner Recherche begründet. Die Vermischung von Meinung und Fakten, das habe ich in meiner Ausbildung oft gehört, sei im Journalismus zu unterlassen. Ergebnis dieser Trennung ist manchmal und vielleicht zu oft ein faktenloses Herumgemeine in Kommentaren und Essays. Stephans Text zeigt, das gerade das Nebeneinander gut funktioniert, wenn es schön sortiert ist. Er schreibt nach dem Fakten-Meinung-Schema, warum die Absage der Buchmesse wirtschaftlich sogar Sinn macht („ist für die deutschen Verlage in Ostdeutschland kaum mehr Geld zu machen“) - und warum er sie trotzdem für falsch hält („Es trifft nur Leipzig. Und als Kollateralschaden wieder einmal: die wunde ostdeutsche Seele.“). „Die Leipziger Buchmesse hätte stattfinden können“, steht am Ende, Stephans Worte, unverschleiert. Und das Schönste an dieser Klarheit, an der Offenlegung ihrer Entstehung: Man kann auch hervorragend anderer Meinung sein.

Felix Stephan über David Hugendick
Die Reportage kann eine einschüchternde Form sein. Ausführliche, geschliffene Texte von bestürzend begabten Autorïnnen, die nicht nur mehr verstehen als man selbst, sondern es auch noch besser formulieren können. In der Zeitung nehmen Reportagen oft ganze Seiten ein, online werden zweistellige Lesezeiten angegeben, bei keiner anderen Textform ist die Strecke, die Leser und Autor gemeinsam zurücklegen, so lang, die Einstiegshürde so hoch, die Bindungsangst so groß.
Es hilft also, wenn man möglichst früh die Verspannungen löst und das Eis bricht, zum Beispiel mit einer kalkulierten Formlosigkeit und einer klar erkennbaren Erzählerfigur. David Hugendick, Literaturredakteur bei Zeit Online, etabliert diese Figur in seinem Porträt des Schriftstellers Wolf Haas direkt im ersten Absatz, mit dem kleinen Wort „jedenfalls“. Es steht am Ende des ersten Absatzes, einer impressionistischen Landschaftsbeschreibung der Stadt Wien, und unterbricht die schriftliche Form unvermittelt durch eine mündliche Geste. Der Autor tritt plastisch aus dem Text hervor, als freundlicher Reisebegleiter mit eigenem Antlitz und eigener Laune. Und diese Laune überträgt sich, das Eis ist gebrochen, die Reise kann losgehen.
Wer sich überzeugen will – bittschön:
Weil es bald um Organe in Kühlschränken, Leichenteile, also um den Tod und diese ganzen Sauereien geht, bestaunen wir einmal ganz schnell das schöne Wien. Die Plaketten und Gedenktafeln, hier lebte, hier komponierte, hier wohnte, hier residierte und so weiter, und bitte noch ein Foto, bevor die Lederschuhtouristen vor die Linse laufen, die Sisi-Kutschen einen wegdrängen und die Wachsjackenfrauen ihre parabolschüsselgroßen Brillen aufsetzen. Wien, erbaut aus Stein und gebrochenen Herzen von Fürsten und Gräfinnen, und die Donau fließt in solider Donaufließgeschwindigkeit vorbei, an Uferpromenadenflaneuren, alten Hunden und trüben Banksitzern, die es ja immer gibt, sogar hier. Jedenfalls: Sonne über Österreich.

David Hugendick über Elisa Schwarz
Das Wort „Vielleicht“ in einer Reportage hat einen schlechten Ruf. Schade. Es kann so schön sein, besonders dort, wo noch immer mit breitbeinigem Reporterstolz Stufen gezählt werden, die irgendwer hinaufläuft, oder Minuten, die jemand auf irgendwas wartet, als hinge etwas von dieser Scheingenauigkeit ab. In Elisa Schwarz‘ Porträt aus der Süddeutschen Zeitung über einen Mann, der seiner Liebe wegen in ein Gefängnis einbricht, heißt es nur lapidar: „Wie oft er schon vor dieser Mauer stand, roter Backstein, vier Meter hoch, vielleicht auch vier Meter fünfzig, so genau weiß das nicht mal die Gefängnisleitung.“ Natürlich hätte die Autorin auch einfach nur „sehr hoch“ schreiben können, das wäre allerdings ungenau. Eine Reporterin mit Maßband hätte hier der Erkenntnis aber auch nicht geholfen.
Ein Vielleicht thematisiert die Grenzen des eigenen Blicks. Es ist ein aufrichtiges Wort. Es tut nicht so, als gäbe es nichts Unverstandenes, als dürften in einem Beschreibungsversuch von Wirklichkeit keine Fragen oder Widersprüche übrigbleiben, die das Bild der „Stimmigkeit“ stören. Das Wort „Vielleicht“ hilft, die Perspektive, aus der erzählt wird, wieder zurückzubinden an die Subjektivität der Autor*in, die eben nicht in Köpfe und Gedanken von Personen kriechen oder an drei Orten gleichzeitig sein kann oder mit Ereignissen schicksalhaft herumspielen sollte – als habe immer alles mit allem zu tun, wenn man nur genug Details sammelt. Ein Vielleicht installiert Zweifel. Das ist kein Fehler, sondern ein Vorzug.
Ein Vielleicht macht einen erzählerischen Text oft auf produktive Weise brüchig. Bisweilen setzt es auch kleine, klar als subjektiv gekennzeichnete Assoziationen in Gang, die aus dem Nichtwissen entstehen. In Elisa Schwarz‘ Artikel heißt es: „Am 17. Oktober 2019 brach Yamen C. in die Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta ein. Wegen Franziska V., wegen der Liebe. (...) Stephan Weil, Mann und Ministerpräsident aus Niedersachsen, schrieb: ‚So leidenschaftlich ist Niedersachsen!‘ Vielleicht sagte er das nur, damit dem Rest der Welt nicht auffiel, wie peinlich das Ganze war. Da baut man ein Gefängnis mit Stacheldraht und Kameras, damit niemand abhaut. Und dann klettert einer die Laterne hoch und steigt da ein, wo alle rauswollen. Wegen ein paar Hormonen.“
Natürlich: Einem Text, in dem es voller Vielleichts, Vermutlichs und Womöglichs wimmelt, möchte man vielleicht selbst nicht mehr viel glauben. Einer Reportage, die vorgibt, alles zu wissen und alles restlos verstanden zu haben, aber noch weniger.

Elisa Schwarz über Julia Schriever
Namen gehören zu Menschen dazu, gerade in Reportagen, wo wir den Leser, die Leserin ja bekannt machen wollen mit einer oder mehreren Personen. Ein Name ist eine erste Beschreibung, ein erstes Bild: Willi Holzapfel, der in einem Kaufhaus arbeitet, Herr Mini, der keine Bahntrasse vor der Haustür will. Was aber tun, wenn jemand seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will? Jemand, der unverzichtbar gute Sachen sagt, ein klassischer Nebenprotagonist also?
Julia Schriever war für die SZ im Coronafrühling 2020 in einem Asia-Restaurant in München unterwegs. Im Buffet dampften die Dumplings, aber es waren keine Kunden da, 88 Stühle und kein einziger Gast. Nur die Restaurantbesitzerin Mama Mok und ein Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen wollte, und den Julia Schriever so vorstellt:
Im Lokal ist (...) ein blonder, gegelter Mann in Armani-Jeans, von dem man nicht so recht weiß, was er hier macht. Er sagt, dass er eigentlich Bauunternehmer ist, aber hier als Kellner aushilft. Mama Mok nennt ihn einfach "diesen Mann". Seit Tagen überlegt Mama Mok mit ihrem Sohn und diesem Mann, wie es weitergehen soll. Der Sohn sagt: "Das Leben ist wie eine Welle, mal auf und mal ab. Und wir sind gerade ein bisschen unten." Dieser Mann sagt im Grunde dasselbe, er formuliert es nur anders: "Das Coronavirus ist nur ein Trend. Den müssen wir jetzt überbrücken."
Julia Schriever hätte auch schreiben können, "Ein Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will", oder "ein Kunde". Dadurch wäre er blass geblieben, ein Geist im Text. Stattdessen hat sie ihm ganz beiläufig eine Kontur gegeben, ein Gewicht, durch ein Detail nur, eine Beschreibung. Wenn also mal wieder jemand seinen Namen nicht sagen will: Vielleicht hat er ja längst einen Spitznamen, wie eben dieser Mann?

Julia Schriever über Vivian Pasquet
Hans Senger schreibt seine Todesanzeige mit blauer Tinte auf ein Blatt Papier. Er notiert: „Hans Senger, geboren am 13. 10. 1935, gestorben am“. Er überlegt. Der Arzt hat gesagt, er habe noch wenige Monate zu leben. Es ist Mai 2013. Wie viele sind eigentlich „wenige“ Monate?
So beginnt Vivian Pasquet ihren Text „Abschied ohne Ende“, erschienen 2014 im Spiegel. Es geht darin um einen Mann, der von seinem Arzt gesagt bekommt, dass er sterben wird. Er verschenkt seine Suppenteller, zieht ins Hospiz – nur der Tod kommt nicht. Vivian Pasquet erzählt in aller Schlichtheit und Genauigkeit nach, wie Hans Senger sich auf seine letzte Reise macht: Wie er seine Todesanzeige formuliert, wie er seine ADAC-Mitgliedschaft kündigt, wie es ihm ein bisschen unangenehm ist, dass er nicht wie ein Todkranker aussieht. Es sind genau diese Details, durch die man sich so gut in den Porträtierten hineinversetzen kann. Man steht mit ihm vor dem Spiegel und wundert sich, warum die Haut nicht langsam gelb wird vom Leberkrebs. Und natürlich will man unbedingt wissen, wie es weitergeht, als die Hospizleiterin irgendwann sagt: man müsse miteinander reden.

Vivian Pasquet über Diana Laarz
Ich mag Texte, bei denen man merkt, wie intensiv sich der Autor oder die Autorin mit den Protagonisten unterhalten hat – und es dann schafft, den Kern des Gesagten in wenigen Sätzen aufzuschreiben, dicht, zart, uneitel. Diana Laarz hat einen solchen Text geschrieben. In "Ein...Und...Aus...Und", erschienen in Geo, beschreibt sie (hier etwas gekürzt) die Not einer Frau mit chronischer Lungenerkrankung so:
Seit 1995 hängt Hannelore Bongard am Schlauch. So nennt sie das. Sauerstoff rund um die Uhr. Der Schlauch in ihrer Wohnung ist zwölf Meter lang, damit kommt sie in jede Ecke. Wenn sie in den Keller möchte, stöpselt sie die zehn Meter lange Verlängerung an, die am Treppengeländer hängt. Vor acht Jahren hat sie ihre besten Freunde in Australien zum letzten Mal besucht. Vor vier Jahren hat sie ihren Blumengarten aufgegeben. Sie schafft es nicht mehr, ihr Haar zu färben, sie findet, das sei für eine Friseurin eine Schande.
Vor allem der letzte Satz, „sie findet, das sei für eine Friseurin eine Schande“, zeigt, wie tief sich Laarz mit der Protagonistin unterhalten hat. Und als Leserin habe ich das Gefühl, Frau Bongards Not in nur diesem einem Satz ganz genau verstanden zu haben.

Diana Laarz über Klaus Bachmann
Der Reporter Klaus Bachmann hat sich den Bereichen der Wissenschaft verschrieben, die für die meisten Leser*innen (inklusive mir) am wenigsten zugänglich sind: Physik, Astronomie und Chemie. Es sind die spröden, harten Themen der Wissenschaft.
Bachmann schafft es allerdings immer wieder, dass ich beim Lesen Heureka-Momente habe - weil er die Welt der Wissenschaft in Bilder aus dem Alltag übersetzt. In einem Text für das GEO-Magazin nimmt er die Leser*innen mit auf eine Reise durch die Ringe des Saturn. Dabei beschreibt er das schwer erklärbare Phänomen der „Bahnresonanz“ – die Beziehungen zwischen Himmelskörpern, deren austarierte Bahnen – folgendermaßen:
„Man kann sich das vorstellen wie auf dem Spielplatz: Töchterchen sitzt auf der Schaukel, Papa schubst sie an und läuft dann bis zum nächsten Schubser um die Schaukel herum. Richtig gut klappt das, wenn die Tochter zweimal hin- und herschwingt, während der Vater eine Runde dreht. Oder sie drei Doppelschwünge schafft, während Papa zwei Umläufe absolviert.“
Mir ist dieses Bild in Erinnerung geblieben. Genauso wie so viele andere Bilder. Bachmann vergleicht Monde mit Schneepflügen und Elektronen mit Tennisbällen. Ja, mit seiner Hilfe habe ich sogar etwas von der Quantentheorie verstanden. Er schafft es, für die kompliziertesten Dinge einfache Beschreibungen zu finden. Weil es so leicht klingt, überliest man dann fast, wie viel Mühe und Sorgfalt es gekostet haben muss, diese Beschreibungen zu finden, die zugleich eingängig und korrekt sind.

Klaus Bachmann über Maik Großekathöfer
Eine junge Frau stirbt an den Folgen der Corona-Impfung. Die Wahrscheinlichkeit der Todesfolge lag bei 1 : 373 500. Allein die nackte Zahl steht über der Geschichte, in der Maik Großekathöfer im Spiegel das Schicksal von Dana Ottmann aus der Perspektive der Mutter schildert. Wie die mit dem Verlust ringt, verdichtet der Autor in einer Passage, die einen beim Lesen den Atem stocken lässt:
Im Badezimmer, dort, wo ihr Kopf lag, befindet sich auf den Fliesen ein kleiner Blutfleck. Das Blut muss Dana aus der Nase gelaufen sein, nachdem sie auf dem Boden aufgeschlagen war. Ihre Mutter bringt es nicht übers Herz, den Fleck wegzuwischen. Petra Ottmann sagt, sie habe das Gefühl, wenn der Fleck weg sei, sei ihre Tochter endgültig verschwunden.
Fein zu beobachten und dann auch noch zu erkennen, welche Beobachtungen den Kern der Geschichte treffen, ist die Kunst. Das hat mich an Großekathöfers Reportage beindruckt, wie er mit einem Detail, über das mancher Autor vielleicht hinweg gegangen wäre, das Leid und die Trauer der Mutter transportiert und damit das leistet, was eine Reportage soll: die Leserin und den Leser mitnehmen.

Maik Großekathöfer über Nicola Meier
Zu viele Reportagen kommen absolut daher; der Reporter, der vorgibt, alles zu wissen, die Reporterin, die angeblich keine Zweifel kennt. Das geht auch anders. Ein guter Text muss kein eindeutiges Urteil fällen, der Autor oder die Autorin kann Fragen stellen, kann nicht Bescheid wissen, kann sich herantasten, eine Ambivalenz ausdrücken. Nicola Meier hat für das SZ-Magazin eine Geschichte über einen Afghanen geschrieben, der nach Bayern geflohen war, den die Ausländerbehörde abschob und der sich ein zweites Mal auf den Weg nach Deutschland gemacht hat. In dem Text erzählt der Afghane zwei Versionen einer Geschichte, die seine erste Flucht erklären soll. Welche davon stimmt? Auch die Begründung für seine zweite Flucht klingt abenteuerlich. Sagt er die Wahrheit?
Nicola Meier schreibt Sätze wie: »Es hörte sich an wie eine Geschichte aus einem Film.« Sie erklärt, dass einige Sätze des Mannes sie stutzig gemacht hätten. Sie schreibt: »Wer bin ich, von meinem sicheren Schreibtisch aus zu hinterfragen, was passiert war?« Sie schildert das Ringen mit sich und ihrem Protagonisten. Sie schreibt:
»Mein Job ist es normalerweise, so lange Fragen zu stellen, bis ich eine klare Antwort habe. Aber was sich vor mehr als zehn Jahren zwischen drei Jungen auf einem Feld in Afghanistan abgespielt hat, wird sich kaum noch herausfinden lassen. Selbst wenn ich nach Afghanistan flöge, um vor Ort zu recherchieren, stünde ziemlich sicher weiter Aussage gegen Aussage. Dass ich es als Journalistin nicht weglassen kann, dass es einen Widerspruch in seinen Aussagen gibt, weiß ich. Dass ich es als Mensch schwierig finde, gehört aber auch zur Wahrheit.«
Die eigene Skepsis und Ungewissheit zu thematisieren, Einwände zuzulassen – das ist modernes Erzählen. Es macht eine Reportage interessanter. Und glaubwürdiger.

Nicola Meier über Anna Kemper
Zu Oft ist es ja so: kein Zugang, keine Geschichte. Neulich, als Argentinien Fußball-Weltmeister wurde, habe ich wieder an eine Reportage von Anna Kemper aus dem Tagesspiegel gedacht. Sie heißt „Der Spieler“ und beweist das Gegenteil. Die Autorin sollte 2009 in Argentinien den damaligen Fußballnationaltrainer Diego Maradona interviewen. Spoiler: Hat nicht geklappt. Aber aus ihren Scheitern, an den Superstar heranzukommen, hat die Autorin einfach einen Erzählstrang für ihre Reportage gemacht. Sie schreibt auf, wie sie bei seinem Pressesprecher erst um 30 Minuten Interview bittet und später um zehn Minuten bettelt. Wie sie nur noch seine Mailbox erreicht: „Mailbox, Mailbox, Mailbox. 14 Mal wähle ich Fernando Molinas Nummer, hinterlasse meine, bitte um Rückruf. Erfolglos.“
Vieles in der Reportage ist klassische Recherche. Anna Kemper guckt sich in Argentinien Trainingsspiele der Mannschaft an, liest Bücher über Maradona, spricht mit Experten. Aber besonders wird der Text dadurch, dass die Autorin weder sich noch ihren Text zu ernst nimmt. Dass sie ihr Scheitern, Maradona zu treffen, immer wieder thematisiert, es als roten Faden nutzt: „Die Wut war eine Art Antrieb“, lese ich in „Ich bin Diego“. „Ich gebe nicht auf. Ich rufe Menotti an, den ich jetzt César nenne, und bitte ihn um Hilfe. Er gibt mir die Nummer von Fernando Signorini, einem Vertrauten von Maradona, den ich zwei Tage später anrufen soll.“ In diesem – ich glaube leider: sehr seltenen – Fall ist es für den Text gar kein Verlust, dass der Hauptprotagonist sich nicht treffen lässt. Sondern ein Gewinn.

Anna Kemper über Annabelle Seubert
Wie schreibt man über etwas, über das alle anderen auch geschrieben und berichtet haben? Die Highdecksiedlung in Berlin ist Anfang Januar voller Journalisten. Es hat gebrannt, Silvesterkrawalle, "Markus Söder spricht von Berlin als 'Chaos-Stadt', Friedrich Merz nennt die Söhne von Migranten 'kleine Paschas'. Ein Gipfel zu Jugendgewalt wird ausgerufen; Integrationsbeauftragte, Migrationsexpertinnen und Gewaltforscher werden zu jungen Männern befragt" schreibt Annabelle Seubert auf ZEITonline in ihrer Reportage "Wir sind die Täter. Immer Täter, Täter, Täter!" Und dann schreibt sie: "Bloß die sogenannten kleinen Paschas fragt man selten: Habt ihr einen Bus abgefackelt? Auf die Feuerwehr geschossen? Warum? Und wie geht's euch überhaupt?"
Genau das macht sie dann. Hängt ab mit den Jugendlichen im Jugendclub "Corner": "Sie sitzen zu zweit auf einem Sessel unter Neonlicht. Beide tragen die gleichen Jacken von Tommy Hilfiger und die gleichen Sneakers von Balenciaga. Hakim trägt Zahnspange. Wenn sie hier telefonieren, dann meist über Lautsprecher: Bruder, wo bist du. Komm jetzt. Komm fünf Minuten. Komm zwanzig. Sag deiner Mutter, ist todeswichtig. Sag, Hamed ist tot."
Sie schreibt nicht über, sie schreibt auf: Was sie sagen, und wie sie es sagen, über Mädchen und Schule, Polizei und ihre Zukunft: "Metalltechnik machen sie, sagen sie. Erzieher, Elektriker, Friseur. Security, in S-Bahn-Stationen oder im Altenheim. Rami, 13, sagt nichts. Rami, was willst du mal werden? Er zuckt mit den Schultern. "Vielleicht Mathe studieren." Rami flüstert. Sie johlen: "Bruder!" "Kanacken!" Studieren? Sie lachen, als fürchteten sie, die anderen ließen sie irgendwann zurück."
Um Silvester geht es auch, aber eher am Rand. Und gerade deswegen bekommt man in Annabelle Seuberts Reportage ein so starkes Gefühl für die Realität in der Highdecksiedlung.

Annabelle Seubert über Esther Göbel
Kerstin ist rastlos, schläft schlecht, sie will ein Kind und will keins. Sie findet es richtig, dass sie sich von ihrem letzten Freund getrennt hat. Aber manchmal fragt sie sich, ob es falsch war.
Kerstin lebt nicht irgendwo, sie lebt in Berlin. Und sie arbeitet auch nicht irgendwas. Ihre Arbeit „ist mehr als Geld verdienen: der Nukleus ihrer Identität, ihre Gedanken nach außen gestülpt“, schreibt Esther Göbel in ihrem Text „Verloren in Optionen“, der 2020 in Reportagen erschienen ist. Sie weiß das so genau, weil sie Kerstin gut kennt: Esther ist Kerstin.
Wie schreibt man einen ehrlichen Text über sich selbst, ohne sich dauernd ironisch von sich selbst zu distanzieren – vor lauter Angst, man könne gefühlig klingen oder zu viel über sich verraten? Der vielleicht auch ein Text über andere ist? Kerstin jedenfalls stellt sich Fragen, die sich auch Michael, Anne oder Elena stellen könnten: Freitagabend Netflix im Bett oder doch raus in „die große Verheißung“? Und wann überhaupt hat man „zum letzten Mal in Ruhe regelmäßig gegessen, drei Mahlzeiten am Tag?“
Esther Göbel hat sich etwas getraut, über das man sich gern lustig macht: Sie hat über sich in der dritten Person erzählt. Sie hat sich einen fremden Namen gegeben, einen, der ihr nicht schmeichelt. Und dann hat sie ihr Leben auf eine Art analysiert, mit der auch Stuckrad-Barre seines in „Panikherz“ beschrieben hat: mit dieser Strenge, die man eigentlich nur sich selbst gegenüber haben kann.

Esther Göbel über David Krenz
Reporter:innen neigen ja oft zu Pathos, immer auf der Suche nach dem nächsten großen Drama. Leider.
Wie erfrischend, wenn ein Autor über eine Qualität verfügt, die selten ist in unserem Business: Bescheidenheit. David Krenz ist so ein Reporter. Einer von der leisen Sorte, der kein großes Aufheben macht und sich Themen widmet, die andere übersehen, eben weil die anderen schon wieder auf der Suche nach dem nächsten großen Drama sind.
Vielleicht hat Krenz deswegen Monate in einen Text über Aale investiert. Ja, richtig: Aale. Diese glitschig-hässlichen Tiere, über die man eigentlich nur denkt: “Iiiiihhh!”
Krenz aber entwickelte während der Recherche eine Faszination für die Glitschmäuler und lernte: Ausnahmslos jeder Aal in Europa wird ganz woanders geboren – tausende Kilometer entfernt, in einem Meeresgebiet vor Florida. Wissenschaftler:innen versuchen seit Jahrhunderten, genau dort einen zu erwischen. Ohne Erfolg. Wie genau die Tiere die 5000 bis 7000 Kilometer nach Europa zurücklegen, nur um sich später, im Erwachsenenstadium, zu Fortpflanzungszwecken wieder auf die Reise nach Florida zu begeben: Niemand weiß es.
So entgleitet der Aal dem Griff der Wissenschaftler:innen, immer wieder. Sein einzigartiger Lebenszyklus bleibt ein Faszinosum. Krenz strickt aus diesem für die Süddeutsche Zeitung einen Artikel über Mensch und Natur, der in einem Schlussabsatz mündet, der pointierter nicht sein könnte: „Ließe der Aal sich leichter finden, ließe er sich besser schützen. Warum macht er es den Forschenden so schwer? Auch aus dieser Frage würde er sich wohl herauswinden.”
Ich bin ein Fan dieses Textes. Vor allem mag ich den allerletzten Satz. Vor allem auch das allerletzte Wort, “herauswinden”. Weil dieses Verb das Sujet des Reporters so wunderbar charakterisiert und nochmal einfängt, dass ich beim Lesen sehr neidisch auf den Autor geworden bin. Viele Reporter:innen widmen sich fast schon fanatisch dem Anfang ihrer Texte. Dabei ist ein guter Schluss genauso wichtig. So einen wie Krenz ihn gebaut hat, würde ich auch gern einmal schreiben.

David Krenz über Johannes Ehrmann
Farben, Gefühle, Empfindungen verblassen. Wie lässt sich in Reportagen dennoch lebendig aus der Vergangenheit unserer Protagonisten berichten? Für möglichst szenische Rückblicke löchern wir sie über Stunden und notieren sämtliche Details, an die sie sich erinnern. Oder meinen, sich zu erinnern.
Johannes Ehrmann will in seiner Reportage „Die Messerwisser“ Zurückliegendes nicht rekonstruieren, sondern erleben. Also macht er sich auf die Socken und spaziert zu Fuß in die Vergangenheit seines Helden, eines Neuköllner Herrenfriseurs.
Der hat seinen Laden (und seine Preise) an die galoppierende Gentrifizierung des Kiezes angepasst, inszeniert sich jetzt als Gentleman-Barbier, der in Zwirn und Hosenträgern Hipstern die Haare schneidet.
"Seit der Herrenfrisör zum Barber Shop wurde, hat sich seine Kundschaft einmal komplett ausgetauscht. Waren es früher … noch 90 Prozent Türken und Araber, schätzt Seif heute den gleichen Anteil aus der westlichen Welt: "Europäer, Kanadier, Amerikaner, so was." Von den alten Stammkunden sei kein einziger geblieben. "Das hat sich aussortiert, ganz von selbst", sagt Seif."
Die Aussortierten hocken nun in derselben Straße ein paar Häuser weiter, beim Billigfriseur „Orient Style“, wo der Schnitt weiter einen Zehner kostet und in den sich kaum ein deutschstämmiger Kunde verirrt. "Wenn hier die echten Deutschen in den Laden gucken und sehen einen Haufen Schwarzköppe...", sagt der dortige Inhaber. Weiter: „Ein Deutscher mit Bart ist ein cooler Holzfäller. Ein Kanake mit Bart ist immer noch ein Kanake.“
Als Gast des Billigsalons erlebt Ehrmann jene Welt, die der Hipster-Barbier durch seinen Imagewechsel hinter sich ließ. Früher war die Nachbarschaft zu Gast in seinen Salons, ein ständiges Kommen und Gehen, laute Diskussionen, manchmal Schreierei … "Gut, dass das vorbei ist." Jetzt kommen die Leute aus der ganzen Stadt, manchmal sogar von außerhalb. Seif ist ein gefragter Mann, weit über Neukölln hinaus.
Reportagelehrbücher predigen das Gegenschneiden von Protagonisten, Schauplätzen und Erzählsträngen, um Texten einen Konflikt, eine Dramaturgie zu verleihen. Oft erscheinen solche Konstruktionen als genau das: konstruiert. Der Bauplan schimmert durch, was einen schnell mal aus den Geschichten reißt. Ehrmann hingegen spaziert so elegant zwischen den Salons und damit vom Heute ins Damals und zurück, dass auch der Leser nie stolpert.

Johannes Ehrmann über Nik Afanasjew
Genau sieben Sätze braucht Nik Afanasjew im Freitag, um beim Leitmotiv seiner Reportage aus St. Petersburg anzukommen. In seinem präzisen Einstieg nähert er sich ihm über eine Detailbeobachtung: "... eine Leuchtschrift in Neonblau verkündet: You are on an island. Alle paar Sekunden erlischt das Wörtchen on. You are an island. Dann sind wir wieder on."
Es ist sofort klar, um was es geht: die seltsame Normalität in einem international isolierten Land. Russland in Zeiten seines Angriffskrieges; ein globaler Inselstaat. Abgesehen von dem Mut, diese Reise überhaupt zu machen: Ein derart genauer Blick für solch ein Detail – das ist kein Reporterglück, sondern Können. Und das ganze Setting in einem so prägnanten Satz zu bündeln, ist mindestens großartiges Handwerk.

Nik Afanasjew über Maris Hubschmid
Bei einem Plot Twist denken wir zuerst an Filme oder Serien. Maris Hubschmid beweist in ihrem Text „Meister der Inszenierung“ für den Tagesspiegel, dass auch Reportagen eine plötzliche Schubumkehr sehr gut vertragen können. Sie schreibt über eine Frau, deren Ehemann an Pseudologie leidet und deshalb ständig lügt — egal, ob es um den angeblich erledigten Einkauf oder Kinder aus vorherigen Beziehungen geht.
Einmal will die Frau ihren Mann zum Valentinstag auf der Arbeit überraschen. Doch als sie seinen Namen nennt, sagt der freundliche Herr am Empfang: „So einen haben wir hier nicht.“ Ihr Mann hat nie in der Behörde gearbeitet, verdient sein Geld als Kundenbetreuer in einem Vertriebsunternehmen. „Dabei haben wir uns zweimal in der Mittagspause vor dem Amt getroffen“, sagt sie. Er stand dann immer schon draußen und wartete.
Obwohl die Rahmenhandlung – eine Begegnung der Reporterin mit ihrer Protagonistin in einer Berliner Kneipe – wenig spektakulär scheint, führt der Text durch ein Leben voller großer und kleiner Unwahrheiten. Ganz am Ende kommt dann die überraschende Wendung, die jedes Wort davor in einem neuen, wahrheitstreuen Licht erhellt. In wenigen Sätzen enthüllt Maris, dass es die Frau ist, die eben das tut, was sie ihrem Ehemann vorwirft: krankhaft lügen.
Der Mann, Frank, bestätigt am Telefon: Er hat es nicht mehr ausgehalten, ihre Lügen. Reden möchte er nicht. Nur so viel: „Was sie Ihnen erzählt hat, ist erstaunlich nah an der Wahrheit.“ Nur, dass es umgekehrt war.
Eben doch fast wie in einem Film wendet sich in der letzten Szene das Blatt. Dieser schnelle, schnörkellose Twist zeigt, warum der stärkste Moment einer Reportage nicht immer für den Einstieg verwendet, sondern auch mal aufgehoben werden sollte. Manchmal bis zum letzten Satz.

Maris Hubschmid über Britta Stuff
Britta Stuff stellt ihrem Text „Wie geht Liebe?“ 1167 kursiv gesetzte Zeichen voran, was bereits mehr sind, als ich hier schreiben soll, weshalb ich sie unmöglich in Gänze wiedergeben kann. Und überhaupt: So ein langer Vorspann, ist das nicht eine Zumutung?
Britta Stuff zitiert – aus einem Buch der Kollegin Annabelle Hirsch – die Antwort einer Anthropologin auf die Frage eines Studenten, welcher Gegenstand als erstes Anzeichen unserer Zivilisation gewertet werden könne. Statt "über einen Tontopf oder eine Speerspitze, (…) irgendetwas Handfestes" zu sprechen, sagt die Forscherin kryptisch: "ein verheilter Knochen." Knochenfunde, die bewiesen, dass ein Mensch vor vielen Jahrtausenden mit einem gebrochenen Oberschenkelknochen überleben konnte, sprächen dafür, dass jemand da gewesen war, um sich dieser Person anzunehmen. Erst dann öffnet sich der Vorhang, um den Blick auf die eigentliche Szenerie dieses Stückes freizugeben: Britta Stuff erzählt vom Leben einer Frau, die seit 40 Jahren ihre von Geburt an schwerstbehinderte Tochter pflegt.
Den Trick, einem Text etwas voranzustellen, kennt man aus der Literatur. In journalistischem Kontext wirkt er schnell prätentiös. in jedem Fall steigert er die Erwartungen an das, was folgt. Was folgt, ist in diesem Fall großartig. Und mit ihrer Entscheidung, die Erzählung so einzuleiten, stellt Britta Stuff unsere Erwartung an die Geschichte gleich zu Beginn vom Kopf auf die Füße: Alles, was wir hier erfahren, gibt nicht etwa Zeugnis eines beklemmenden Einzelschicksals, sondern verhandelt im Gegenteil das große Ganze: das Menschsein.

Britta Stuff über Lena Niethammer
Das journalistische „ich“ kann peinlich sein, es kann schnell angeberisch wirken. Viele versuchen deshalb, es zu vermeiden, schreiben „man“, oder schlimmer: „Autorin dieser Zeilen“. Jedenfalls: Die Autorin dieser Zeilen liebt Lena Niethammers Text „Sieht mich jemand?“ im Tagesspiegel. Er handelt von einem Mann, der sich „Dose“ nennt, einsam ist und im Internet nach Gesellschaft sucht. Lena Niethammer schrieb ihr Porträt Jahre nach dem ersten Treffen, und es beginnt so:
"Dose hat mir die Tiere hinterlassen. Die Tiere und das bisschen Innehalten. Mir wurde das bewusst, als neulich eine Maus durch die Kneipentür entwischte. Sie kam aus dem Hinterzimmer, wich gerade noch einem Paar schwarzer Stiefel aus, und kurz bevor die Tür ins Schloss fiel, entkam sie ins Freie. Ich dachte, das hätte Dose jetzt gefallen. Er hätte da gesessen, die Maus vielleicht als Einziger bemerkt und wäre für einen Augenblick glücklich gewesen."
Ich habe den Text bestimmt fünfzigmal gelesen, weil er so warm ist. Ich glaube, das liegt auch an dem rührenden „ich“, das ihn durchzieht. So legt Lena Niethammer offen, was eh fast immer der Fall ist bei Porträts: Der Text handelt nicht nur vom Beschriebenen, sondern auch vom Schreiber.